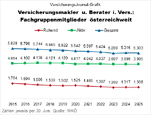Führung mit KI, nicht durch KI
 23.7.2025 – Künstliche Intelligenz ist ein mächtiges Hilfsmittel beim Führen. Sie kann menschliche Führung aber nicht ersetzen. Welche Grundsätze Führungskräften als Richtschnur für die Nutzung von KI dienen können. – Von Barbara Liebermeister. (Bild: Liebermeister)
23.7.2025 – Künstliche Intelligenz ist ein mächtiges Hilfsmittel beim Führen. Sie kann menschliche Führung aber nicht ersetzen. Welche Grundsätze Führungskräften als Richtschnur für die Nutzung von KI dienen können. – Von Barbara Liebermeister. (Bild: Liebermeister)
Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.
Im Abonnement erhalten Leserinnen und Leser mehr Information. Das frei zugängliche Archiv enthält die Artikel des VersicherungsJournals der letzten 30 Tage. Premium-Abonnenten können darüber hinaus alle bisher erschienenen Beiträge abrufen. Das sind seit Februar 2008 pro Jahr mehr als 860 Beiträge, also über 6.000 Quellen wertvoller Fachinformationen.
Das Premium-Abonnement kostet 34,90 Euro pro Jahr (inklusive Mehrwertsteuer) pro Jahr, also weniger als 3 Euro pro Monat oder 0,15 Euro pro Arbeitstag. Für Firmennetzwerke mit fester Internetadresse („IP-Nummer") wird es je nach Anzahl der Arbeitsplätz noch deutlich günstiger.
Es bestehen zwei Möglichkeiten für die Registrierung zur Benutzung des Archivs.
Nach erfolgreicher Eingabe Ihrer Daten bekommen Sie den Freischaltungscode direkt per E-Mail zugesandt und können umgehend auf das Archiv zugreifen.
Dieser Zugang ist für Einzelnutzer geeignet, die flexibel von jedem Computer aus per Login auf das Archiv des VersicherungsJournals zugreifen möchten. Benutzername und Passwort können Sie selbst wählen.
Dieser Zugang ermöglicht den Zugriff auf das Archiv des VersicherungsJournals über die Erkennung Ihrer IP-Adresse. Ein Login mit Passwort und Benutzername ist nicht erforderlich. Dieser Zugang ist nur möglich für Netzwerke mit fester IP-Adresse (typisch für größere Unternehmen, in der Regel nicht bei einfachen Internetzugängen).
Möchten Sie Artikel ohne Registrierung abrufen, so können Sie jeden Text über GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH einzeln für einen geringen Stückpreis erhalten. Direkt auf diesen Artikel bei Genios gelangen Sie hier.